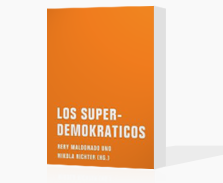Das Netz lauert. Es registriert jede Bewegung. So wie im Frost jede Bewegung durch Kontakt mit der kalten Luft schmerzt, macht auch das Internet jede Bewegung kristallin, sichtbar, vereinzelt, erstarrt. Bögen, die mich früher trugen, muss ich gegen das Internet durchhalten, als trüge ich mich selbst als wasserempfindliches Hologramm über meinem Kopf, während ich durch einen reißenden Strom wate. Ich lebe jedoch immer noch nach dem Prinzip, man muss sich in den Strom stürzen, nicht zögern.
Ich hätte nie gedacht, dass technisch zu machen wäre, dass überall Strom ist.[1]
Mein freies Leben setzt sich aus Zerstreutheit zusammen. Bei jeder Blockade in einer Aufgabe gibt es andere, die leichter gelöst werden können. So postmodern wie meine eigenen Zellen funktioniere ich. Kein fixes Fließband ist meine Arbeit, sondern ein Raum mit osmotisch fließenden Grenzen, in denen die RNA, Proteine etc. (Arbeitsanweisungen und Kopien) herumschweben und ich das Nächstbeste greife, was mich aufgrund seiner Natur und meiner Bereitschaft anzieht. Mein Gehirn funktioniert so, meine Nahrungsaufnahme, meine Freundschaften.
Es zieht mich hin zu Leuten, die im Internet Genuss finden und Lebensart haben. In der Stadt, auf Feldwegen, auf Gartenparties, in Diskos, immer bin ich auf der Flucht. Da entsteht keine Lebensart. Immer bin ich auf Besuch. Dankbar, wenn man mich mag. Dankbar auch für Struktur, Zwänge – denen ich ja allzuleicht entkomme – Rhythmen. Wenn es kein Internet gibt, kann ich einen Haufen Arbeiten jetzt nicht erledigen, das macht die Orientierung leichter. Wenn es draußen sehr unwirtlich ist, stärkt es meinen Entschluss, bei einer Sache zu bleiben.
Das Internet kann man kennen, man kann es bauen, es entspricht Strukturen des Denkens. Es kann ein Lächeln sein, wenn man seine Musik versteht. Es ist doch wie das Werk eines Komponisten. Man muss es lesen können, etwas heraushören. Die Partitur an sich ist unsinnlich. Was für eine riesige Wolke an Kompetenz es doch jetzt gibt! Und die Systeme sind immer noch komplexer, das Internet ist uns in allen Richtungen immer voraus, wie dem Grottenolm der Boden, dem Wal das Meer. Wir sind darin kompetent, aber an ein Ende kommen wir nie.
Freedom is wasted on the free, singt Neil Hannon (Divine Comedy).
Ich gehöre nicht ins Internet. Auch nicht in eine Familie. Auch nicht an eine Uni. Doch zieht es mich dort hin. Ich will nicht mehr Resultate produzieren! Ich wuerde gerne in einen Arbeitsprozess integriert werden. Einen, den nicht ich selber alleine ausgedacht habe. Heißt das nicht schlicht, ich kann mit der Freiheit meiner freien Arbeit nicht umgehen? Ich meine, es hat auch eine andere Komponente. Es braucht die Fiktion von Resultaten, von Achievement, einen naiven Glauben ans Fertig-Werden und eine ungeheuer robuste Perfektionstheorie, um als freier Dienstleister nicht verrückt zu werden. Oder man schafft sich den Arbeitsplatz selber, indem man sich mit Kollegen, die auch so frei umherschwirren, befreundet. Dass sie auch Konkurrenten sind, wäre im Buero genauso der Fall, das ist nicht das Problem. Zweideutige Beziehungen sind der Normalfall. Und dann baue man sich nach und nach eine gemeinsame Orientierung, erarbeite sich, ohne isolationsbedingt verrückt zu werden, eine vernünftige Einstellung zur eigenen Arbeit und deren Beziehung zu den so unterschiedlichen Kontaktpersonen. Hierin könnte die Freiheit wirklich der Boden für das werden, was man an Paradies mit Menschenmitteln bauen kann. Die Isolation ist in der Freiheit eigentlich leicht zu lindern.
Das Problem an der Freiheit ist der Wunsch. Der Wunsch ist ja an sich nie frei. Er kennt die verzwicktesten Winkel der Seele, wo er seine Wurzeln einschlägt, wenn alles schon die reinste Skaterhalle der Wollust geworden ist. Um den Wunsch zu erkennen, muss man die eigenen Unfreiheiten erkennen. Fehlt äußerliche Unfreiheit, gegen die sich der Wunsch sonst sammelt, ist er schwer aufzufinden und funkt ungreifbar herum. Die Möglichkeit, im Internet immer woanders hinzugehen, wirkt wie ein Aufheben des Leidens. Man leidet höchstens, weil man ungeschickt ist oder Schnupfen hat oder Empathie. Wer seine Wünsche kennt und ihnen vertraut, handelt in der Welt wie im Internet meist geschickt, wie auch der, der ein kräftiges Programm hat, dem er folgt. Nur wer das Leiden meidet, kommt in die merkwürdige Situation des Leidensentzuges, das auch ein Freudenentzug ist. Auf ein ewiges Kind wie mich, das will, was es sieht, und vergisst, was es nicht sieht, wirkt das Internet so fatal schützend wie ein Laufkäfig: Man kann fast überall hin, ist aber nicht richtig dort. Und das, was einen wirklich interessiert, ist – das weiß ich genau – woanders.
[1] Ist auch nicht.

 Themen
Themen