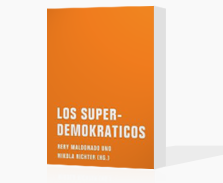Caracas sangrante, das blutende Caracas, wie der Künstler Nelsón Garrido es sieht.
Letzte Woche, auf einem meiner zahlreichen Spaziergänge durch die Universität, sah ich eine Katze. Ihre vier Pfoten schmiegten sich eng an ihren Körper, wie die Form einer Blumenvase, während sich ihr Schwanz in eine samtige Spirale drehte. Eine normale, gewöhnliche Katze, könnte man sagen, hätten ihr nicht die Gehirndecke gefehlt. Dies zu bemerken und sofort wegzurennen, war ein fast elektrischer Impuls. Dennoch war die Würde, mit der das Tier diese Situation ertrug, für mich ein Muss, mich umzudrehen und es wenigstens ausführlich zu beobachten.
In den darauffolgenden Tagen bekam ich das Bild jener Katze mit ihrem Gehirn im Freien einfach nicht aus dem Kopf. Ob sie von einem Auto angefahren worden war? Oder kam die Verletzung von einem Kampf mit einem Hund? Ich konnte es nicht herausfinden. Aber viel mehr noch beschäftigte mich die Tatsache, dass ich es mir selbst zur Aufgabe machte, mich mit diesem Schmerz auseinanderzusetzen.
Eine Woche später musste ich nach Maracaibo reisen, eine Stadt im Osten Venezuelas, um dort an einem nationalen Treffen der „Escuela de Letras“ (Geisteswissenschaftlichen Fakultät) teilzunehmen. Als wir auf dem Weg zur Buchpräsentation auf der Avenida 16 Guajira waren, sahen wir einen Pulk von Menschen auf dem Gehweg, einen Bus, der quer zur Fahrbahn stand und die Leiche eines jungen Mannes, sein Gehirn war über die Fahrbahn verteilt. Dieses Mal fühlte ich nicht einmal den Impuls, meinen Blick abzuwenden, sondern versuchte, das Szenario zu entschlüsseln, während unser Auto weiterfuhr. Am nächsten Tag, am 16. Juli, berichtete die Zeitung La Verdad („Die Wahrheit“) über den Vorfall in einer Nachricht. Der Junge war 19 Jahre alt, er hatte sich aus dem Bus gestürzt, weil ein Krimineller die Fahrgäste des Busses ausrauben wollte. Der Junge war auf dem Gehweg und der Straße gelandet und der Busfahrer hatte nicht verhindern können, dass der Hinterreifen des Busses ihn überrollte. Der Verbrecher hatte lediglich ein Tafelmesser bei sich gehabt. Diese Tatsache und der Tod des jungen Mannes hatten die Wut der Fahrgäste erregt, so dass sie den Räuber fassten, ihn an einen Laternenmast fesselten und ihn zu verprügeln begannen. Zu seinem Glück fuhr genau in diesem Moment der Wagen der Bürgermeisterin von Maracaibo vorbei, und damit wurde die Lynchjustiz verhindert.
Man sollte meinen, das Bild der Katze habe mich darauf vorbereitet, den Eindruck der Leiche des Jungen abzuschwächen. Das ist ein gefährlicher Gedanke: Er birgt die Idee, dass manche Schmerzen schlimmer als andere oder dass sie gerechtfertigt sind, da sie für andere Schmerzen Vorarbeit leisten. Der Präsident Chávez musste beispielsweise ein Krebsleiden erfahren, um Mitleid für einige politische Gefangene empfinden zu können, die unter der gleichen Krankheit leiden und die über ein Jahr lang erfolglos versuchten, das Recht auf eine medizinische Behandlung einzufordern.
Die Tragödie, mit einer Regierung zu leben, die aus einem Personenkult besteht, liegt darin, dass sich die Probleme des Landes unter die Sorgen eines einzigen Bewohners unterordnen müssen. Gewalt und Angst vor Verbrechen zählen bis zum heutigen Tag nicht zu den präsidentiellen Sorgen. Genau wie es in „Inseguridad y Violencia en Venezuela. Informe 2008“ (Alfa, 2009) (dt. „Buch der Angst vor Verbrechen und Gewalt in Venezuela. Bericht von 2008“) dargestellt wird: Die Zahl der Morde stieg in den ersten zehn Jahren der Regierung Hugo Chávez aud das Dreifache an, bis sie bislang unbekannte Dimensionen in der Kriminalgeschichte des Landes annahmen. Von 4.550 registrierten Morden im Jahr 1998, als Chávez mit seiner Wahlkampagne an die Macht kam, sind wir mittlerweile bei 13.157 registrierten Morden allein im Jahr 2007 angelangt.
Diese Zahlen haben sich seither einfach nur multipliziert. An einem einzigen Wochenende, vom Freitag, den 22. Juli bis zum Sonntag, den 24. Juli 2011, ereigneten sich allein im Stadtgebiet von Caracas 54 Morde. An jenem Wochenende gab die Regierung die Ergebnisse der Analyse der sterblichen Überreste Simón Bolívars bekannt. Und dabei wurden zwei wesentliche Dinge bewiesen: Es handelte sich tatsächlich um die Überreste von Bolívar und, was das noch viel wichtiger war: Er war tot. Die Forschungen der Wissenschaftler deuteten auf eine unbekannte Krankheit als Todesursache des Libertador, des großen Unabhängigkeitskämpfers, hin. Hugo Chávez war trotzdem nicht überzeugt, wie er im nationalen Rundfunk bestätigte. Der Präsident von Venezuela bestand darauf, dass der Nationalheld des Vaterlandes ermordet worden war.
Bolívar starb 1830. Nur 181 Jahre später näherte sich Chávez der Lösung des Falles. Wenn Bolívar schon so lange warten musste, dann können die 100.000 Ermordeten, die während der Amtszeit Chávez registriert wurden, ja wohl auch noch ein bisschen warten! Wenn es um Helden geht, ist das Leben der anderen genauso viel wert wie Straßenkatzen.
Übersetzung: Barbara Buxbaum

 Themen
Themen